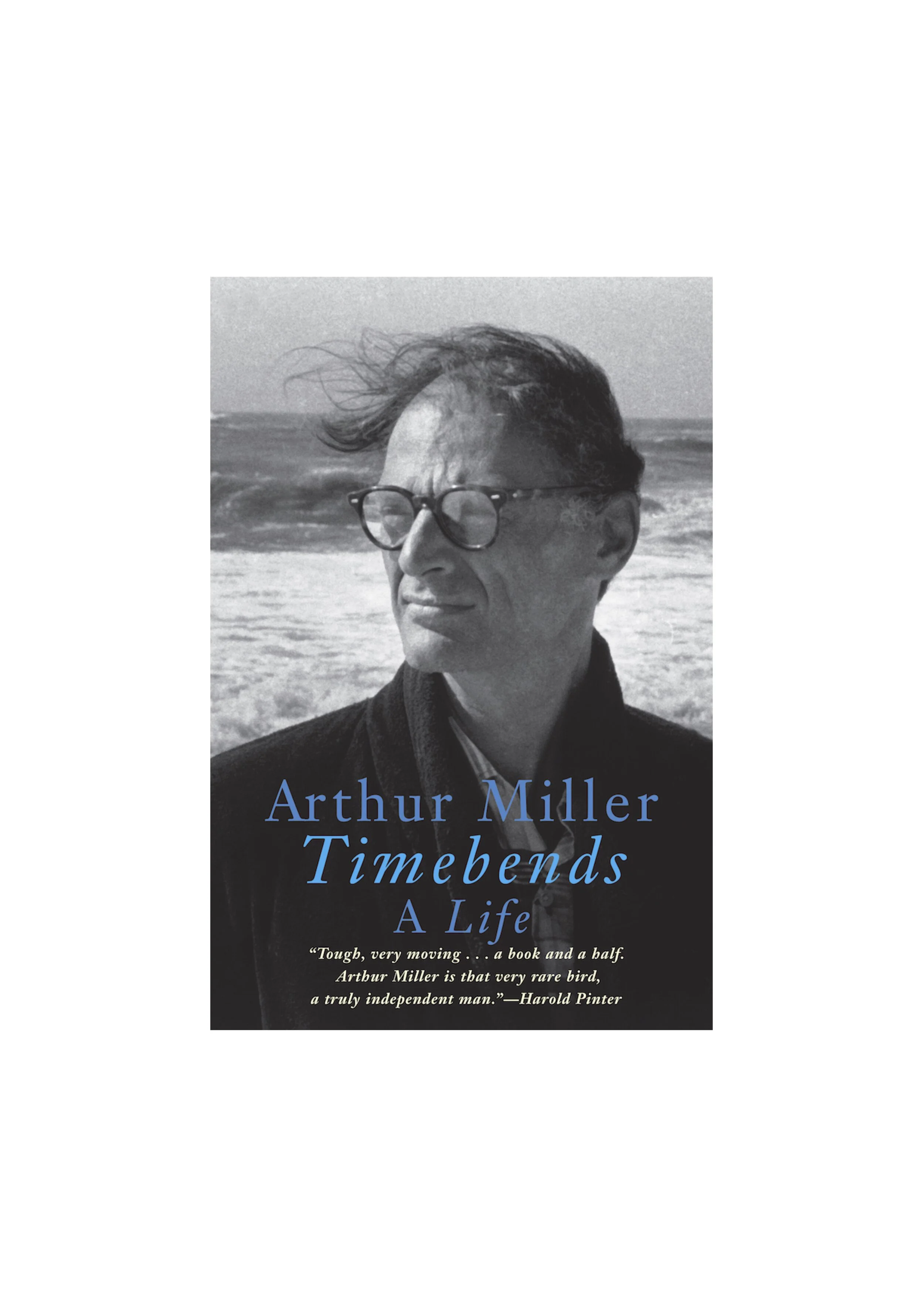Für Sie war das eine ähnliche Geschichte. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass auch Sie unheimlich Heimweh hatten und sehr gelitten haben unter dieser Umsiedlung. Nach wie vor haben Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft und sind dem Land sehr verbunden. Wie haben Sie seit Ihrem Umzug die Entwicklung in den USA miterlebt?
Sehr kritisch und sehr schmerzlich. Die ersten Jahre hatte ich wirklich noch Heimweh und war noch ganz stolz. Wir waren in Österreich, am Salzkammergut und wenn dort einmal amerikanische Militärjeeps und Lastwagen vorbeifuhren, schlug mein Herz sofort höher. Ich stand an der Seite und beobachtete sie. Auch Kennedy war noch ein ganz großes Idol von mir. Da war ich Anfang 20.
Aber ab dem Vietnamkrieg ging es sehr, sehr bergab. Ich habe darunter gelitten, dass Amerika die Rolle eines Weltpolizisten spielte. Auch wenn Kennedy innenpolitisch gute Politik machen wollte, seine Außenpolitik war eine Katastrophe. Ob das Kuba war oder seine Vorbereitung des Vietnamkriegs... Er hätte den Krieg fast angefangen und hätte ihn auch geführt, aber ist dann umgebracht worden. Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Tode ist der Vietnamkrieg dann losgegangen. Von diesem langen katastrophalen Krieg hat sich Amerika nie erholt. Und der ganze weitere Niedergang, den ich erlebt habe in den Achtzigerjahren, ... Reagan, eine Katastrophe! Solche Leute haben Amerika heruntergezogen. Bei Bush wollte ich meine amerikanische Staatsbürgerschaft schon zurückgeben, aber habe das dann glücklicherweise nicht getan. Da kam plötzlich das Wunder von Obamas Präsidentschaft. Etwas völlig anderes! Aber effektiv konnte er auch nur vier Jahre regieren. Während der zweiten Legislaturperiode hatte er ja immer mit der republikanischen Mehrheit im Kongress zu kämpfen. Aber wer hätte gedacht, dass es noch einen Präsidenten wie Trump geben wird? Das ist ja noch viel schlimmer als alles zuvor.
Ich höre heraus, dass Sie, seitdem Sie das Land verlassen haben, die politische Entwicklung in den USA als stetige Verschlechterung empfunden haben.
Ja, genau. Ich habe trotzdem Hoffnung. Die Vereinigten Staaten sind die älteste Demokratie. Sie haben nicht wie England eine parlamentarische Monarchie gehabt. Sie kannten von Anfang an keinen König. Sie haben überlegt, ob sie George Washington zum König krönen wollen. Aber nein, sie haben es nicht gemacht. Die amerikanische Demokratie hat schon viele Krisen durchgemacht: den Bürgerkrieg und die Große Depression und all die Geschichten. Es ist ein wahnsinniges Auf und Ab gewesen. Die Amerikaner haben eine riesige Zahl von abgeschlachteten Ureinwohnern auf dem Gewissen. Dazu kommt deren massenweise Versklavung. Und trotzdem: Sie haben zwischendurch ihre ganz großen Zeiten gehabt. Amerika ist ein extremes Land. Deswegen ist irgendwo in mir doch noch etwas hängen geblieben an Hoffnung und an Sympathie.
Das ist ein sehr schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich möchte genauer auf die Vortragsreise eingehen, die Sie im letzten Herbst durch die USA unternommen haben. Sie trägt den programmatischen Titel „Democracy will win“. Was macht Sie da so optimistisch?
Das war eigentlich gar nicht mal optimistisch gemeint, sondern eher kämpferisch. Der Titel stammt im Grunde aus dem Jahr 1938. Da hieß die Rede meines Großvaters „The Coming Victory“. Es war die Zeit, in der der Faschismus noch richtig greifbar war. Ganze Länder in Europa waren völlig von ihm eingenommen und man konnte ihn nur mit Krieg vertreiben. Das war greifbar, das war sichtbar, man schickte eine Armee hin und gewann. Dies war das „win“, das bei Thomas Mann mitschwang, und das habe ich sozusagen übernommen, in der Hoffnung, ein bisschen Mut zu verbreiten.
„Democracy will win“ ist im Grunde eine Botschaft an die Amerikaner. Ich will sie auffordern oder ermutigen, die völlige Stagnation in der Sprachlosigkeit, in der Feindseligkeit der Menschen untereinander, zu überwinden. Und im Kleinen können sie das ja auch gut. Warum können sie sich nicht zusammenfinden und auch über die großen Fragen anders diskutieren als jetzt? Diesbezüglich habe ich auf meiner Vortragsreise übrigens ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In Denver im mittleren Westen, zum Beispiel, haben zahlreiche High-School-Direktoren meine Besuchsanfragen abgelehnt. Die Polarisierung sei zwischen den Kindern und auch zwischen den Eltern zu groß. „Das gibt so viel Unruhe.“ Die haben alle abgesagt. So etwas wäre undenkbar gewesen in Washington, New York oder in Los Angeles. In Kansas habe ich zwar eine High School besucht, aber das Gespräch war nicht einfach. Ein Lehrer fragte mich dort, „Was halten Sie eigentlich von dem sozialistischen Gesundheitswesen in Deutschland?“
Und was haben Sie geantwortet?
„Ich halte sehr viel davon“, habe ich gesagt. (lacht) Ich bin dann gar nicht mehr dazu gekommen, zu erklären, dass „Sozialismus“ bei uns was anderes heißt. Das hatte keinen Sinn. Da waren 90 Kids, vier Lehrer und ich wollte mich nicht mit allen anlegen. Es war mehr ein Versuch, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. In Washington war ich an in einer High School mit lauter afroamerikanischen Schülern. Das war eine völlig andere Situation. Zwei Stunden lang habe ich gemeinsam mit einem tollen Lehrer den Unterricht über Demokratie geleitet. Also da habe ich unterschiedliche Welten erlebt – und deswegen auch dieser Titel „Democracy will win“: Einfach vorwärts blicken.
„Democracy will win“ ist eine Botschaft an die Amerikaner, die völlige Stagnation in der Sprachlosigkeit zu überwinden.”
Was haben Sie für Rückmeldungen bekommen, wie die Jugendlichen die politische Situation in ihrem Land bewerten? Gab es auch Antworten, die Sie überrascht haben?
Also überrascht hat mich der Besuch in Kansas City. Die 90 Schüler dort waren sehr still. Nur einige haben sich zu Wort gemeldet und ganz verwunderliche Dinge gesagt. Als ich fragte, „Was haltet ihr eigentlich von dieser Mauer, die der Präsident an der mexikanischen Grenze bauen will?“, kam sehr Unterschiedliches. Einige sagten, „die Mauer ist wichtig, damit die Schmuggler und die ganzen Verbrecher, die da kommen, gebremst werden“. Andere sagten, „Nein, nein, wir wollen es nicht so machen wie in Berlin mit der Berliner Mauer, da sind wir dagegen“. Also das war ein Hin und Her, aber nur wenige haben etwas gesagt. Anschließend kamen aber einige nach vorne, haben mir stumm die Hand geschüttelt und sich bedankt. Da ist irgendetwas abgelaufen, das ich vorher nicht mitbekommen hatte. Irgendwie waren die froh, dass da einmal einer kam und einfach sagte, was er denkt.
Sie haben gerade beschrieben, dass die Resonanz auf Ihren Besuch sehr unterschiedlich ausfiel – je nachdem, in welcher Region Sie waren. Wie haben Sie die Zielorte bei Ihrer Vortragsreise ausgewählt?
Das war gar nicht ich. Die Lesereise habe ich in Kooperation mit dem Thomas Mann House geplant, wo ich im Frühjahr letzten Jahres auch als „ Honorary Fellow“ war. Der Programmdirektor des Thomas Mann House Dr. Blaumer hat die Tourziele zusammen mit Ansprechpartnern des Goethe-Instituts in Washington, Kansas und New York zusammengestellt. Ich glaube, er hat sich ein bisschen an den Reisen, die Thomas Mann zwischen 1938 und 1943 unternommen hat, orientiert. Es kamen bei mir zwar nicht 15 Städte heraus, aber immerhin 12.
Aber der Fokus lag schon auf den Küsten, oder?
Ja, ganz klar. Die Reise hat an der Küste, in New York, angefangen, ging dann ein bisschen hin und her, ziemlich bald in die Mitte, dann wieder zurück nach Washington, anschließend ganz in den Westen, bis in den Norden, dann nach Kalifornien und schließlich zurück nach New Hampshire. Alles in allem sechs, sieben Wochen.